|
Lehr- und Lernprojekt „Die Eule“ Messtechnik und Sensorik
Die
von Menschen kontrollierten Vorgänge in der Naturwissenschaft und der
Technik nutzen Messverfahren, um den Verlauf von Prozessgrößen zu
überwachen und zu dokumentieren.
Wir entwickelten daher für den Bachelorstudiengang Maschinenbau an der
TU Berlin die Veranstaltung Messtechnik und Sensorik, um den
Studierenden ein solides Grundlagenwissen der Messtechnik / Sensorik zu
vermitteln, dies durch praxisrelevante Übungen mit modernem Equipment
zu festigen und die Basis für eine lebenslange Weiterbildung zu
schaffen.

Durch
die Kopplung mit der Vorlesung „Messtechnik und Sensorik“ erlangen die
Studierenden in den Übungen praxisgerechte Kenntnisse neuester
Messprinzipien und Messmethoden, testen die Robustheit verschiedener
Messverfahren und vergleichen das Preis-, Leistungsverhältnis
kommerziell verfügbarer Messgeräte. Schwerpunkte bilden elektrische und
sensorische Verfahren zur Quantifizierung von nichtelektrischen und
elektrischen Größen sowie die modular aufgebaute Signalkette zur
digitalen Messwertverarbeitung.
Bei der Entwicklung der Lernmodule beteiligten sich alle Mitarbeiter
des Fachgebiets mit großer Begeisterung. Es entstanden völlig neue
Übungseinheiten, bei denen sowohl die Wandlung physikalischer Größen in
elektrische Signale als auch die Einbindung der Messverfahren, z. B. in
die Fertigungs- oder Automatisierungstechnik im Vordergrund stehen. Die
Module werden von Professor Lehr und den Assistenten des Fachgebiets
auf ihre technische Relevanz, Vollständigkeit und Tiefe der
Wissensvermittlung ständig überprüft und optimiert. Das
vorliegende Lehrangebot in der Messtechnik und Sensorik geht damit weit
über kommerziell verfügbare Module hinaus.
Diese Lehrveranstaltung wurde vom Präsidium der TU Berlin
mit dem Prädikat
"sehr erfolgreich" geehrt.
----
Hier das gesamte Spektrum
der völlig neu konzipierten
und selbst entwickelten Übungseinheiten:
-
Bedienung der Messgeräte, Messstatistik, Messung von Widerständen
Die einführende Übung in die Messtechnik vermittelt
Know-how über die eingesetzten Geräte: Frequenzgenerator,
Laborschaltnetzteil, Digital-Multimeter und Oszilloskop. Es werden
Widerstände vermessen, eine Mess-Statistik ausgewertet und
Grundlagen der Fast-Fourier-Transformation erläutert. Kenntnisse
über die verwendeten Geräte und Methoden gelten in den
Entwicklungsabteilungen als selbstverständlich.
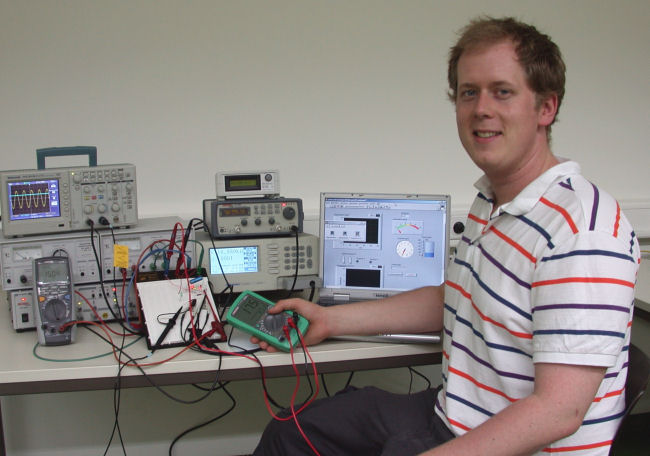
Florian Bühs demonstriert die Vielfalt der messtechnischen Möglichkeiten
----
Weg- und Winkelmessung mit resistiven Aufnehmern
Die Übung führt in die Messung von Winkeln und
Längen mit Hilfe von variablen Widerständen (Potentiometer)
und unterschiedlichen Schaltungsvarianten zur Auswertung
wegabhängiger Widerstandswerte ein. Im praktischen Teil werden
Potentiometer als Spannungsteiler und als Abgleichelement einer
Messbrücke eingesetzt, wobei sich der Weg, bzw. der Winkel durch
Messung der Ausgangsspannung sehr präzise ermitteln lässt.
Potentiometer- und Brückenschaltungen werden im Maschinenbau und
im allgemeinen Industriebereich genutzt.
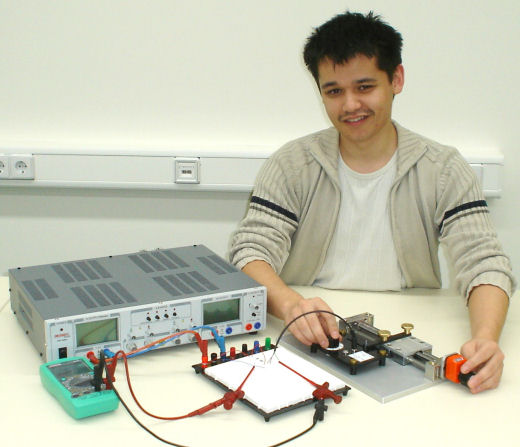
Marcus Schulz zeigt, wie man Winkel mit resistiven Aufnehmern bestimmt
----
Kraftmessung mit Dehnungsmessstreifen
Die Übung vermittelt Grundlagen zur Messung mit
Dehnungsmessstreifen (DMS) und zeigt Schaltungsvarianten zur Steigerung
der Messempfindlichkeit. Anhand eines Biegebalkens wird die Verwendung
der Dehnungsmessstreifen zur Kraftmessung verdeutlicht. Im praktischen
Teil wird an belasteten Biegebalken die Dehnung vermessen. Die
Resultate zeigen die Vor- und Nachteile der einzelnen Messtechniken.
Der Einsatz von DMS erfolgt in allen Bereichen der Technik: Bestimmung
von Kraft, Drehmoment, zur Spannungsanalyse und zur
Überlastüberwachung.

Jens Prochnau testet Brückenschaltungen für Dehnungsmessstreifen
----
Temperaturmessung
Die Temperatur ist eine der wichtigsten Messgrößen
im Bereich der Technik, so dass sich eine Vielzahl von Messverfahren im
Einsatz befinden. Die Übung gibt zunächst einen umfassenden
Überblick zu den wesentlichen physikalischen Prinzipien. Im
experimentellen Teil bestimmen die Studierenden den
Temperaturgradienten eines zunächst einseitig erwärmten
Messingblechs, das anschließend auf der anderen Seite
gekühlt wird. Die Messung wird mit Thermoelementen, einem
Pt100-Widerstandsthermometer und mit einem
Infrarot-Strahlungsthermometer durchgeführt.
Temperaturaufnehmer lassen sich zur Temperaturüberwachung von
Prozessen in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie einsetzen.
Strahlungsthermometer kommen z. B bei Wartungs- und Prüfarbeiten
in der Flugzeug- und Stahlindustrie zum Einsatz.
René Péau kontrolliert die Temperatur an der Vergleichsstelle
----
Wechselspannungsmesstechnik, kapazitive Abstandsmessung
Aufbau von Grundschaltungen (Hoch- und Tiefpass,
Schwingkreis) der Wechselspannungs-messtechnik mit Kapazitäten und
Induktivitäten. Im praktischen Teil wird das Verhalten eines
Hochpasses mittels Bode- Diagramm untersucht. Anhand der Resonanzkurve
eines Serienschwingkreises lässt sich demonstrieren, welche
Messempfindlichkeit in der Nähe der Resonanz erreichbar ist. Als
Beispiel für kapazitive Messprinzipien wird die Abstandsmessung
vorgestellt und mit einem Sensor auf einer Linearführung
vermessen. Anwendungsgebiete: Weg- und Abstandsmessung, Verbesserung
der Messempfindlichkeit durch Hoch-, Tiefpass und Filterkreise.

René Péau führt die Übung zur Vermessung von Blind- und Scheinwiderständen vor
----
Magnetfeldvermessung am C-Magneten mit Hall-Sensoren
Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit
elektromagnetischen Kreisen. Anhand von Magnetfeldmessungen am
C-Magneten ergibt sich der Beitrag des Werkstoffs zur magnetischen
Induktion im Luftspalt, wobei Begriffe wie Sättigung, Remanenz und
Koerzitivfeldstärke deutlich werden. Durch Variation des
Luftspalts und des Stroms lässt sich die magnetische Induktion B
einstellen. Die resultierende Feldverteilung wird mittels Hallsensor
vermessen. Die Magnetfeldmesstechnik wird zur Abstands-, Drehzahl-,
Strommessung sowie zur Bestimmung der Feldrichtung in Motoren und
Schaltern eingesetzt.

Eugen Olenew und Walter Vogel vermessen Magnetfelder am C-Magneten
----
Induktive Weg- und Abstandsmessung
Induktive Verfahren ermöglichen eine genaue Messung
großer Wege und Abstände. Anhand des induktiven Messprinzips
wird der Einfluss verschiedener Kernmaterialien auf die
Induktivität einer Spule veranschaulicht. Experimenteller Teil:
induktive Wegmessung mit einer Differentialdrossel in einer
Brückenschaltung. Als weiteres Verfahren zur Abstandsmessung wird
das Wirbelstromprinzip in einem Demonstrationsversuch verdeutlicht.
Induktive Verfahren kommen bei der Vermessung von Schichtdicken, bei
Metalldetektoren, zur Minensuche und bei der Qualitätskontrolle
(Rissprüfung) zum Einsatz.

Tino Schmidt präsentiert die Abstandsmessung mit der Differentialdrossel
----
Magnetische Wegmesssysteme
Magnetische Wegmesssysteme sind weit verbreitet, da sie
preisgünstig, robust und einfach zu handhaben sind. Sie nutzen
hochempfindliche Magnetsensoren, die auf dem GMR-Effekt beruhen,
wofür Peter Grünberg 2007 den Nobelpreis erhielt. In der
Übung werden magnetoresistive Sensoren eingesetzt, verschiedene
Bauarten vorgestellt, das Prinzip der inkrementellen, magnetischen
Wegmessung erläutert und im praktischen Teil der Übung anhand
von zwei Versuchen veranschaulicht. Mit zwei Sensoren lässt sich
die Bewegungsrichtung erkennen. Die Einsatzgebiete betreffen die
Wegmessung in schmutziger Umgebung (z.B. Aufzüge) sowie
Präzisionsmesseinrichtungen für Werkzeugmaschinen aller Art.
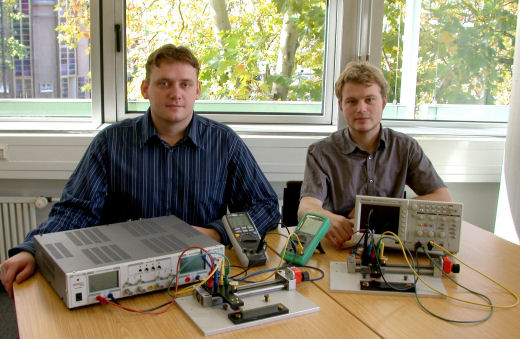
Walter Vogel und Eugen Olenew erläutern das Prinzip der magnetischen Wegmessung
----
Digitale Frequenzmessung
Digitale Schaltungen gewinnen in der Messtechnik an
Bedeutung. Ihre Störsicherheit in rauer Umgebung, der modulare
Aufbau sowie die Kompatibilität zur Rechnerperipherie
prädestinieren sie für umfangreiche Aufgaben. Anhand
einfacher Aufbauten gilt es, sich mit dem Prinzip der digitalen
Frequenzmessung vertraut zu machen und die Technik der
Signaldetektierung bei der Drehzahlmessung mit einem Hall-Sensor bzw.
einer Induktionsspule kennen zu lernen. Die digitale Drehzahl- und
Frequenzmessung kommt an rotierenden Maschinen zum Einsatz und nimmt in
der Niederfrequenz- und Hochfrequenzmesstechnik eine dominierende
Stellung ein.
Abgleich der Amplituden für die Drehzahlmessung durch Dmitrij Demjanenko
Codierung in der Messtechnik, sequentielle Messdatenübertragung
Maßstäbe lassen sich über eine Reihe von
Techniken auslesen. Hierzu zählen optische, magnetische, induktive
und auch mechanische Abtastsysteme, deren Maßverkörperung
binär gestaltet ist. Eine weitere Verfeinerung stellt der
Gray-Code dar. In der Übung werden Grundlagen der Codierung
vermittelt, das Prinzip der seriellen Messdatenübertragung mit der
Multiplexer- bzw. Schieberegister-Schaltung vorgestellt und an
experimentellen Aufbauten demonstriert. Technische Anwendungen von
Codier- und Decodierschaltungen sind beispielsweise bei der
Absolutmessung von Strecken zu finden, während serielle
Übertragungstechniken die sichere Übertragung von Messdaten
gewährleisten und die Vielfalt von Leitungen erheblich reduzieren.
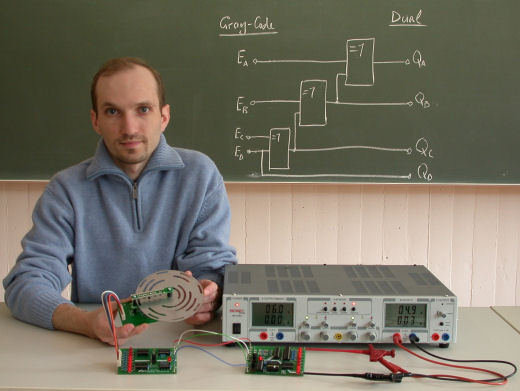
Dmitrij Demjanenko erläutert die Messung von Drehwinkeln
mit einer Gray-Code Scheibe
Kapazitive und piezoelektrische Beschleunigungsmessung
Die Übung beschäftigt sich mit Verfahren zur
Beschleunigungsmessung und Schwingungsanalyse. Für die Aufnahme
quasistatischer Beschleunigungen wird eine kapazitive Technik
eingesetzt, wohingegen die Messung höherfrequenter Schwingungen
mit einem piezoelektrischem Sensor erfolgt. Als Messobjekt dient in
beiden Fällen ein mit einem Frequenzgenerator angesteuerter
Lautsprecher. Die Datenanalyse erfolgt mit einem Oszilloskop durch
Auswertung der Messdaten im Zeit- und Frequenzbereich. Betrachtungen
der Grenzfrequenz der beiden Sensoren ermöglichen die
Einschätzung von Sensorapplikationen im Bereich der Technik.
Kapazitive Beschleunigungssensoren kommen vor allem als GPS-Ersatz zur
Trägheitsnavigation und zur Messung niederfreuenter Schwingungen
im Auto zum Einsatz. Piezoelektrische Beschleunigungssensoren
überwachen den Zustand von Maschinen, zeigen Verschleiß an
und verhindern dadurch größere Unfälle.
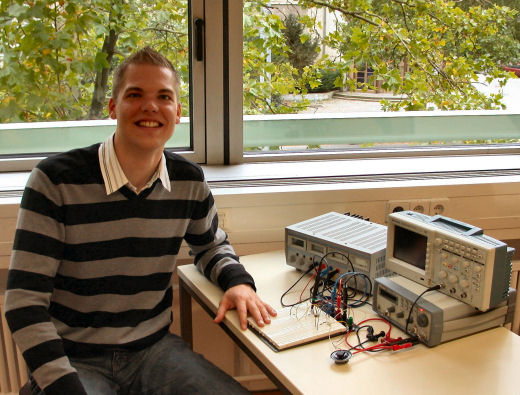
Daniel Brüggemann präsentiert einen elektrodynamischen Schwingungserzeuger
für die Erprobung von Sensoren
----
Inkrementelle optische Wegmessung mit Richtungserkennung
Optische Inkrementalgeber sind in vielen Bereichen der
Technik im Einsatz, da sie prinzipiell eine hohe Messgenauigkeit
ermöglichen, wenn die Lichtquelle, der Lichtempfänger, das
Blendensystem sowie die elektronische Pulsverarbeitung geeignet
aufeinander abgestimmt sind. Die Übung beschäftigt sich mit
den zugrunde liegenden Messprinzipien und erläutert anschaulich
den Messaufbau sowie die zugehörige elektronische
Auswerteschaltung zur Erkennung der Richtung bei der Relativbewegung
zweier Objekte. Anhand einem Vergleich von optischen und magnetischen
Wegmesssystemen werden mögliche Einsatzgebiete in der Industrie
diskutiert und beispielhaft vorgestellt, da optische Inkrementalgeber
bei vergleichsweise geringem Aufwand ein Höchstmass an
Messgeneuigkeit zur Bestimmung von Wegstrecken liefern.

Eugen Olenew und Walter Vogel testen ihren selbst entwickelten optischen Inkrementalgeber
----
Optische Abstandsmessung: Lasertriangulation und konfokaler Sensor
Die Übung beschäftigt sich mit Methoden der
optischen Abstandsmessung, speziell mit der Analyse des
grundsätzlichen Funktionsprinzips optischer Sensoren. Nach der
Diskussion verschiedener optischer Verfahren werden anhand geeigneter
Messaufbauten experimentell Stärken und Schwächen der
Lasertriangulation und der konfokalen Technik untersucht. Neben diesen
Verfahren wird auch das Reflexionsverhalten verschiedener
Oberflächen geprüft. Die Lasertriangulation ist heute ein
bevorzugtes Verfahren, da sie eine berührungslose Abstands- und
Schwingungsmessung ermöglicht. Konfokale Verfahren werden bei der
Qualitätskontrolle im Motorenbau sowie im Bereich der Mikrotechnik
für die Messung von Oberflächenstrukturen eingesetzt.
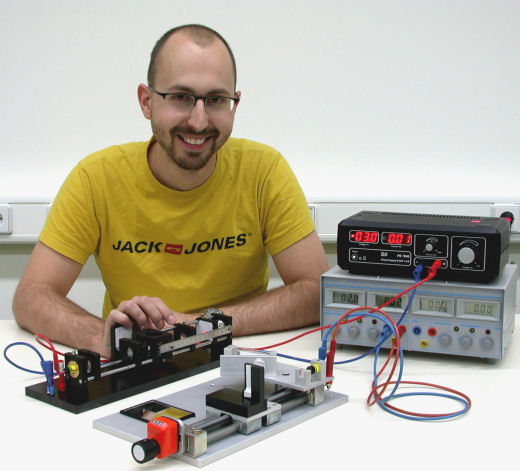
Mathias Winter zeigt Methoden der optischen Abstandsmessung
----
Interferometrie, Messung am Michelson-Morley Interferometer
Die Interferometrie ist ein modernes optisches Messverfahren
mit einem Auflösungsvermögen bis in den Nanometerbereich.
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und hohen
Genauigkeit wird sie in der Forschung und Industrie vielfach
eingesetzt. Die Übung vermittelt anhand praktischer Versuche an
einem Michelson-Morley-Interferometer die Grundlagen des Verfahrens.
Neben der Längenmessung wird auch auf optische Eigenschaften und
Besonderheiten wie die Kohärenzlänge eingegangen.
Interferometrische Messverfahren werden bei der Weg- und
Abstandsmessung an hochpräzisen Produkten sowie in der Halbleiter-
und Mikrotechnik und der Oberflächenbearbeitung eingesetzt.
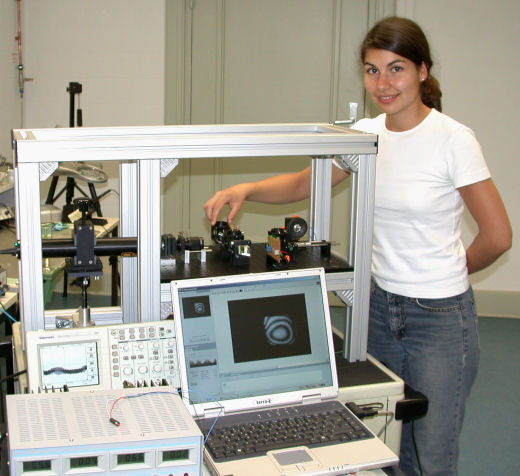
Manisha Lakhani justiert das Michelson-Interferometer
----
Interferenz und Beugung
Beugungsphänomene begrenzen die Auflösung optischer
Instrumente. Diesem negativen Sachverhalt steht gegenüber, dass
die Beugung an Gitterstrukturen heute in vielfacher Weise zur
Erforschung der Struktur der Materie dient.
Zwei grundlegende Experimente belegen in dieser Übung die
Wellennatur des Lichts: Interferenz an dünnen Schichten sowie das
Doppelspaltexperiment von Thomas Young.

Robert Schulz weist die Wellennatur des Lichts mit dem Doppelspalt-Versuch nach
----
Automatisches Messsystem auf der Basis von LabVIEW
Bei der experimentellen Bestimmung quantitativ
erfaßbarer Größen sind häufig mehrere
Messgeräte erforderlich mit denen die Untersuchung eines
großen Parameterbereichs durchzuführen ist. Anstatt
ermüdender und zeitraubender Messungen lässt sich mit LabVIEW
ein automatisches Messsytem erstellen, das den Messvorgang in einfacher
und effizienter Weise erledigt. Es werden zwei Demonstrationsversuche
durchgeführt: die Bestimmung der Beschleunigung und die
Aufprallkraft an einer schiefen Ebene sowie die messtechnische
Erfassung des Einflusses einer Wirbelstrombremse auf die Schwingungen
eines physikalischen Pendels. LabVIEW wird für automatisierte
Messprozesse im Labor, im Messfeld sowie bei der
Qualitätskontrolle eingesetzt.
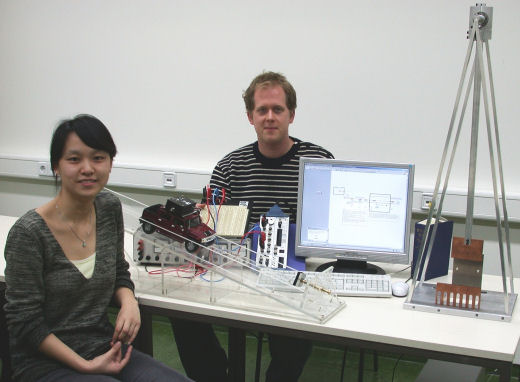
Jing Wang und Florian Bühs erklären automatische Messverfahren mit LabVIEW
----
So geht es vor Ort in den Übungen zu ...

... erst eine Einführung in die Theorie und Auffrischung der Vorlesungsinhalte ...

... dann selbst die Messgeräte einstellen und eigene Daten erzeugen ...

... Überprüfung und Diskussion der Ergebnisse
----
----
Es folgt ein Auszug aus dem OWL-Antrag des Fachgebiets Mikrotechnik:

Here comes the OWL
Mittelzuweisung an das Fachgebiet Mikrotechnik aus dem TU-Programm:
Offensive Wissen durch Lernen ---- OWL
Der neu konzipierte Bachelorstudiengang Maschinenbau an der
TU Berlin sieht die intensive Vermittlung naturwissenschaftlicher
Lehrinhalte vor. Ziel ist es dabei, ein solides Grundlagenwissen der
Elektrotechnik / Elektronik und Messtechnik / Sensorik aufzubauen, dies
durch praxisrelevante Übungen zu festigen sowie die
Befähigung zur lebenslangen Weiterbildung in diesen Bereichen zu
schaffen.
Zum Aufbau eines neuen Praktikums Messtechnik / Sensorik, in
dem Studierende des Maschinenbaus moderne messtechnische Methoden
vermittelt bekommen, erhält das Fachgebiet Mikrotechnik Mittel aus
dem OWL-Programm der TU Berlin. Da die am Fachgebiet Mikrotechnik
vorhandenen Praktikumsplätze und die Zahl der Geräte für
die erhebliche Zahl von Studierenden (300 pro Semester in der
Bachelorausbildung des Maschinenbaus) nicht ausreichen, sind
Investitionen erforderlich, um neue Übungsplätze aufzubauen
und diese mit modernem Equipment auszustatten.

Attention please
Nach der Studierendenbefragung wird die bisherige Ausbildung
auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik als unbefriedigend
empfunden. Als Gründe werden genannt: fehlende
„hands-on“-Praxis in den Übungen / Praktika, mangelnde
Vermittlung von Grundlagen, veraltete Übungs- und Lehrinhalte.
Schließlich fehlt auch eine gründliche Ausbildung in der
Messtechnik, deren Basis elektrotechnische / elektronische Inhalte
bilden.
Jedoch werden spätestens bei der Durchführung der
Studien-, Projekt- und Diplomarbeiten die einschlägigen
Fertigkeiten benötigt. Das dann zusätzlich notwendige
aufwendige Selbststudium verschlingt wertvolle Zeit und verzögert
den Studienabschluss.

Please listen carefully
Die Messtechnik war bisher nicht Bestandteil der Ausbildung
im Grundstudium des Maschinenbaus. Diese Lücke wird im
Bachelorstudiengang Maschinenbau der Fakultät V nun durch die
Veranstaltung des Fachgebiets Mikrotechnik geschlossen. Eng gekoppelt
an die zweistündige Vorlesung „Messtechnik und
Sensorik“ erlangen die Studierenden in den begleitenden
Übungen praxisgerechte Kenntnisse von Messprinzipien und
Messmethoden.
Anhand einfacher Demonstrationsversuche erarbeiten die
Studierenden zunächst die physikalischen Prinzipien, die bei
kommerziell erhältlichen Messwertaufnehmern oder -wandlern zur
Erfassung der jeweiligen Größen dienen. Anhand verschiedener
Messaufgaben mit vorkonfigurierten Geräten lässt sich dann
ein praktischer Vergleich der unterschiedlichen Messverfahren und
-techniken, z. B. zur Längen-, Kraft-, Drehmoment- oder
Druckmessung durchführen. Ziel ist es, Fachkompetenz aufzubauen,
um bei konkreten Messaufgaben aus der Vielzahl möglicher
Lösungen eine problemgerechte Auswahl treffen zu können.
Dabei gilt es, auch Begriffe zu klären und z. B. anhand von
Beispielen den Aufbau sowie die für die Praxis relevanten Vor- und
Nachteile kommerziell erhältlicher Produkte herauszuarbeiten.
Außer der Betrachtung des Preis-/
Leistungsverhältnisses oder der Robustheit der möglichen
Messprinzipien, liegt der Schwerpunkt auf dem Messen von
nichtelektrischen und elektrischen Größen mit elektrischen
Verfahren und der elektronischen Weiterverarbeitung der Signale. Diese
Signalkette ist für den modularen Aufbau von Messanlagen sowie zur
digitalen Messwertverarbeitung geeignet und wird heute überwiegend
in der Produktion eingesetzt. Wesentlich ist dabei, praktisches
Know-how anhand von modernem Messequipment aufzubauen.

You get the complete look-through after these courses
|
|
|